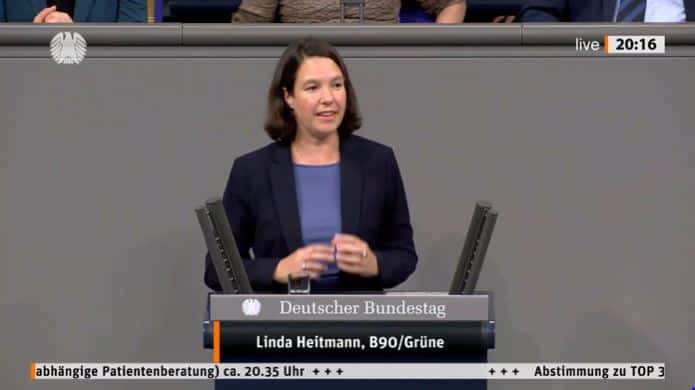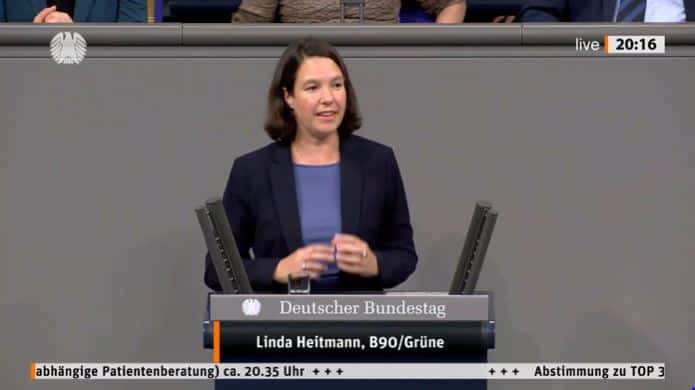
22. Sep. 2023
Gestern Abend haben wir auf Antrag der Linkspartei die Situation der Unabhängigen Patientenberatung debattiert. Ich habe dabei auf unsere Erfolge verwiesen und verdeutlicht, warum es wichtig für die Patient*innen ist, die Unabhängige Patientenberatung staatsfern aufzustellen, damit ihre Finanzierung nicht jedes Jahr von haushaltspolitischen Abwägungen abhängig ist. Meine ganze Rede findet Ihr unten im Video:

7. Juli 2023
Plädoyer für eine gesundheitsorientierte Reform des Straf- und Maßregelvollzugs. Gemeinsames Autor*innen-Papier mit den Grünen Gesundheits- und Rechtspolitiker*innen Canan Bayram MdB, Dr. Kirsten Kappert-Gonther MdB, Toni Schuberl MdL und Kerstin Celina MdL zur Debatte um die Versorgung von psychisch- und suchtkranken Straffälligen
Der Bundestag hat gerade unter dem Titel der Reform des Sanktionenrechts über die Neufassung verschiedener Paragrafen im Strafgesetzbuch beraten. Grundlage hierfür war die vorangegangene Arbeit einer parteiübergreifenden Bund-Länder Gruppe. In der Zusammenarbeit wurden rechtspolitisch gute Ergebnisse erzielt, um die akuten Missstände anzugehen und einen Systemcrash abzuwenden.
Der Gesetzentwurf ist daher aus gesundheits- und rechtspolitischer Perspektive ein guter Anfang. Er kann jedoch nur die Ausgangslage bilden für die weitere gesellschaftlich offen geführte Debatte über die Reformierung des Maßregelvollzugs nach Paragraf 64 Strafgesetzbuch (StGB). Mittel- und langfristig muss ein Gesamtkonzept erarbeitet werden, das auch die Perspektive des Justizvollzug sowie der ambulanten, gemeindespsychiatrischen und stationären Versorgung in Freiheit mitdenkt.
Paragraf 64 StGB regelt, inwiefern suchtkranke Straftäter*innen, bei denen die Tat auf den Konsum von Alkohol oder andere Betäubungsmitteln zurückzuführen ist und die eine Bereitschaft zur Behandlung haben, im Zuge ihrer Verurteilung in den Maßregelvollzug anstatt in den regulären Vollzug kommen. Die aktuell diskutierte Reform ist darauf angelegt, den Maßregelvollzug – eine klinische Therapieeinrichtung für psychisch- und suchtkranke Menschen – dauerhaft zu entlasten. Wir gehen daher davon aus, dass künftig dadurch deutlich mehr suchtkranke Straftäter*innen in regulären Haftanstalten untergebracht werden. Das bleibt solange unbefriedigend, wie die Versorgung von psychisch- und suchtkranken Häftlingen in Justizvollzugsanstalten deutlich schlechter ist als im klinischen Setting des Maßregelvollzugs. Es ist aber eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, – auch vor dem Interessenshintergrund einer erfolgreichen Rehabilitation und dem Menschenrecht auf gute Gesundheitsversorgung, – straffällige Menschen vernünftig medizinisch und therapeutisch zu behandeln, wenn sie den Willen dazu zeigen.
Aus unserer Sicht kann das nur gelingen, wenn Bund und Länder an einem Strang ziehen, um hier die Voraussetzungen und Bedingungen deutlich zu verbessern. Dafür legen wir fünf konkrete Vorschläge vor:
- Angleichung der Bedingungen zur Versorgung therapiewilliger Sucht- und psychisch Kranker in Haft
Das Recht auf Gesundheit ist ein Menschenrecht, das auch für Personen in Gefangenschaft gelten muss: Im Maßregelvollzug nach § 64 StGB sowie für Gefangene im regulären Vollzug muss die Nutzung aller zur Verfügung stehenden (psycho-)therapeutischen und medikamentösen Behandlungsoptionen ermöglicht werden, d.h. Motivation, Entgiftung, Entwöhnung und Rehabilitation, einschließlich einer Opioid gestützten Substitutionsbehandlung (mit allen Substituten) sowie Arbeit/Beschäftigung, soziale Kontakte und Beziehung. Menschenrechte sind universell, unveräußerlich und unteilbar. Deswegen müssen auch im regulären Vollzug alle suchtbezogenen Therapie- und Hilfeangebote, die Menschen im Maßregelvollzug bekommen können, zugänglich sein. Hier muss im Grundsatz gelten: Für jeden und jede inhaftierte Person muss die bestmögliche Therapieoption ermöglicht werden. Sowohl für Männer als auch für Frauen müssen adäquate Angebote geschaffen werden. Dafür müssen wir an bundesweit einheitlichen Standards arbeiten. Gute Behandlungsmöglichkeiten in der Haft sind bereits der Grundstein für eine gelingende Rehabilitation.
Viele ärztliche – und psychotherapeutische Gespräche in Haft gestalten sich auch deshalb schwierig, weil es Sprachbarrieren gibt. Gerade zum Haftantritt ist es aus unserer Sicht unabdingbar zu klären, welche psychischen und/oder Suchterkrankungen möglicherweise vorliegen und inwiefern die inhaftierte Person therapiewillig ist. Wir fordern daher einen Anspruch auf Sprachmittlung für all jene, bei denen es unüberwindbare Sprachbarrieren schon im Gerichtsverfahren und anschließend im Erstgespräch bei Haftantritt gibt, sowie eine diskriminierungskritische Versorgung. Der Anspruch auf Sprachmittlung muss ebenfalls für alle medizinischen und therapeutischen Hilfen während der Haft und Rehabilitation gelten.
Welche Sucht- oder psychischen Erkrankungen bei Inhaftierten in Deutschland vorliegen, ist nur schwer zu analysieren, da die Datenerhebungen derzeit in den einzelnen Bundesländern nicht nach einheitlichen Kriterien und nicht zum selben Zeitpunkt erfasst werden. Es ist uns ein Anliegen, dass Feststellung und statistische Erfassung der Erkrankungen überall bei Haftantritt nach denselben Kriterien erhoben werden und diese in die nationale Gesundheitsstatistik künftig einfließen. Nur so ist es auch möglich, systematisch an Verbesserungen zu arbeiten.
- Neue Wege in der Personalgewinnung
So sehr wir bessere Behandlungsbedingungen für suchtkranke und psychisch kranke Menschen in Haft sowie im Maßregelvollzug für erforderlich halten, so klar sehen wir auch in Gesprächen mit Praktiker*innen vor Ort, dass die Personalgewinnung ein massives Problem darstellt. Gerade Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen sind dringend gesucht. Das Justizwesen und auch der Maßregelvollzug werden von diesen Berufsgruppen bislang nicht als attraktiver Arbeitsort wahrgenommen und auch die Vergütung ist noch nicht gut genug. Wir empfehlen daher, dass die Bundesländer die Arbeitsbedingungen inklusive Bezahlung gerade für Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen besser ausgestalten und zudem innovative Wege der Personalgewinnung gehen: In einigen Bundesländern, so etwa in Hamburg, ist der Dienst in Haft für angehende Ärzt*innen oder Sozialarbeiter*innen eine wahlobligatorische Station in der Ausbildung. So lernen sie den Arbeitsort kennen und entscheiden sich später ggf. eher dafür, hier regelhaft tätig zu werden.
- Kommission einsetzen – Reform in Bezug auf ihre Zielsetzung, der Stärkung von Prävention und Resozialisierung, von Beginn an evaluieren und neue Strukturen entwickeln
Die aktuelle Reform ist ein Schritt in die richtige Richtung. In der Folge braucht es aber eine umfassende Reform. Dafür soll eine Kommission, ein interdisziplinäres und interministerielles begleitendes Gremium aus Expert*innen und Praktiker*innen eingerichtet werden. Diese soll mit entsprechenden Haushaltsmitteln ausgestattet werden.
Die aktuelle Reform soll in Bezug auf ihre Zielsetzung – der Stärkung von Prävention und Resozialisierung – evaluiert werden. Dies setzt eine Zusammenarbeit an der Schnittstelle von Rechts- und Gesundheitspolitik im Bund und in den Ländern voraus, um die systemischen, medizinischen und rechtlichen Fragen in den Blick zu nehmen und alle Beteiligten an einen Tisch zu holen.
Es braucht die Expertise aller Beteiligten, wie der Fachgesellschaften, der Justiz- und Gesundheitsressorts der Länder und des Bundes, der Betroffenen-Vertreter*innen, des Suchthilfesystems und der psychiatrischen und psychosozialen Einrichtungen, diese komplexe Debatte zur Verbesserung und Modernisierung der Versorgung von Menschen mit psychischen und Suchterkrankungen in Haft zu führen und das Versorgungssystem in gesamtgesellschaftlichem Interesse zu reformieren.
Der Spiegel hat das Thema aufgegriffen. Hier findet ihr den Beitrag, und noch einmal etwas ausführlicher hinter der Paywall hier.

23. Juni 2023
„Was nachweislich tötet, muss nicht auch noch nach Vanille schmecken!“ In meiner Rede zur Änderung des Tabakerzeugnisgesetzes habe ich damit unseren Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir zitiert. Denn wir haben gestern beschlossen, sogenannte charakteristische, oftmals süße Aromen für Tabakerhitzer zu verbieten und die Hersteller zu verpflichten, Warnhinweise in Wort und Bild auf ihre Produkte zu bringen. Beides galt bereit für Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen.
Ich finde, das ist ein weiterer Baustein hin zu mehr Verhältnisprävention. So stärken wir die Gesundheitsorientierung in der Suchtpolitik. Es braucht jedoch noch einiges mehr, damit Rauchen gerade auch für Jugendliche nicht mehr cool ist und sie gar nicht erst damit anfangen. Was ich mir vorstelle, könnt ihr in meiner Rede hören.

5. Apr. 2023
In unserem Koalitionsvertrag auf Bundesebene haben wir niedrigschwellige, gesundheitliche Versorgungskonzepte fest verankert. Auf Hamburger Landesebene sind in der Vorhabenplanung ebenfalls die lokalen Gesundheitszentren etabliert, die in jedem Bezirk eingerichtet werden sollen. In meinem Wahlkreis Hamburg-Altona wird bald das Gesundheitszentrum Osdorf eröffnen. Vorab habe ich es gemeinsam mit Filiz Demirel, grüne Bürgerschaftsabgeordnete für die Elbvororte, besucht.
Dort ist geplant, dass die Berater*innen künftig mit sämtlichen Gesundheitsakteur*innen der Umgebung bis nach Lurup hinein kooperieren – von Familienhebammen bis zur Krebsberatung. Sie wollen niedrigschwellig zu allen Themen rund um Ernährung, Bewegung oder Medikamenteneinnahme selbst beraten und Menschen auch an die Angebote in der Umgebung weitervermitteln. Im Vorfeld gab es bereits eine erste Bedarfsanalyse mit dem Ergebnis, dass in dem Stadtteil überdurchschnittlich viele Menschen von Asthma, Adipositas und Herzproblemen betroffen sind, häufig auch schon im Kindesalter. Gleichzeitig ist die Hemmschwelle für einen Arztbesuch oft recht hoch und es gibt vielfach auch Sprachbarrieren.
In dem Multifunktionsraum des Zentrums sollen künftig Begegnungen und auch Sport- oder Beratungskurse stattfinden können. Impfaktionen sind hier ebenfalls denkbar. Die Trägerschaft des künftigen Gesundheitstreff hat die AWO inne und finanziert wird es über Gelder von Stadt und Bezirk.
Der Standort für das Zentrum ist gut gewählt
Am Seiteneingang des Born Center, wo viele Osdorfer*innen ihre täglichen Besorgungen machen, ist auch der Eingang zum Gesundheitszentrum zu finden. In dem Haus selbst haben sich auch schon länger mehrere Ärzt*innen niedergelassen und in der Nachbarschaft des Gesundheitszentrums sind ein Pflegedienst und eine Apotheke untergebracht. Nur eine gynäkologische Praxis sowie eine vernünftige Hebammen-Abdeckung fehlen im Umfeld des Zentrums noch, um auch eine gute Versorgung für insbesondere junge Frauen zu ermöglichen.
Die Sprachmittlung ist auch hier ein Thema
Aktuell sprechen die Berater*innen Russisch, Englisch und etwas Französisch. Dennoch ist eine große Bandbreite an Sprachen nicht abgedeckt, weshalb das Zentrum mit Sprachmittler*innen kooperieren will, um auch mehrsprachige Beratung in großen Umfang anzubieten. Zwei Mal die Woche wird es eine offene und einmal pro Woche eine Sprechstunde mit Termin geben. Menschen mit und ohne Versicherungsschutz haben hier künftig insgesamt eine gute Anlaufstelle.
Ich freue mich sehr über das Angebot in Osdorf und will es in Zukunft gerne eng begleiten.

27. Jan. 2023
Gestern war der Tag des Patienten!
Passend dazu haben wir das Gesetz zur Reform der Unabhängigen Patientenberatung (UPD) im Bundestag in 1. Lesung debattiert.
Ich habe dabei deutlich gemacht, wie wir die wichtige, seit dem Jahr 2000 bestehende Institution bekannter, unabhängiger und schlagkräftiger machen wollen. Viel Spaß beim Anhören.
Nun freue ich mich auf die parlamentarischen Beratungen.
Die Debatte und meine Rede wurde von aerzteblatt.de aufgegriffen.