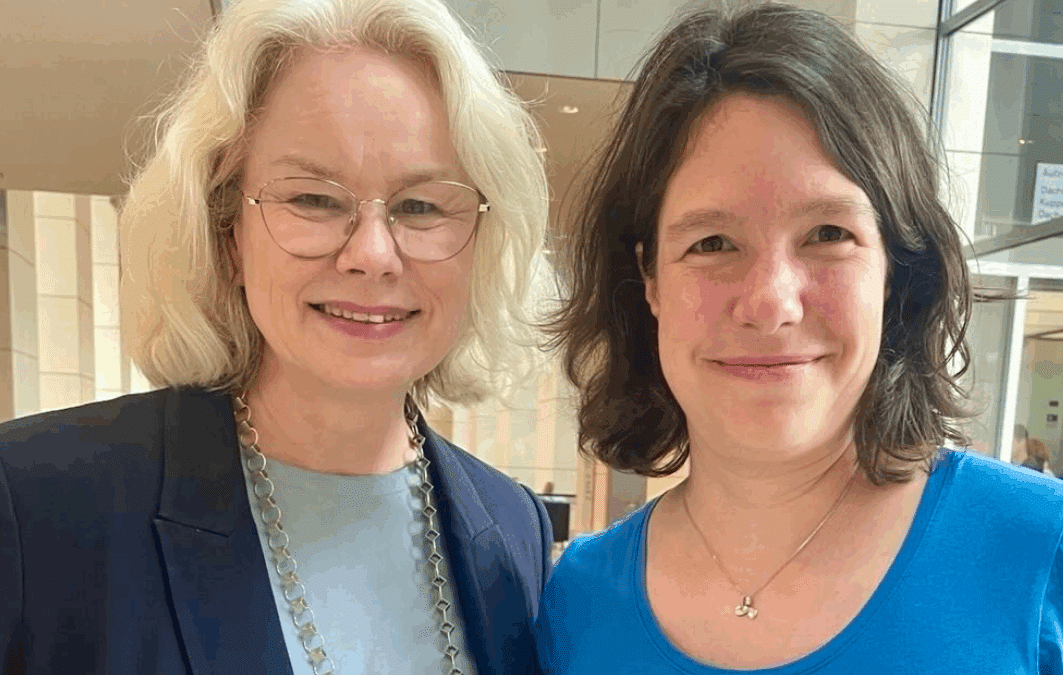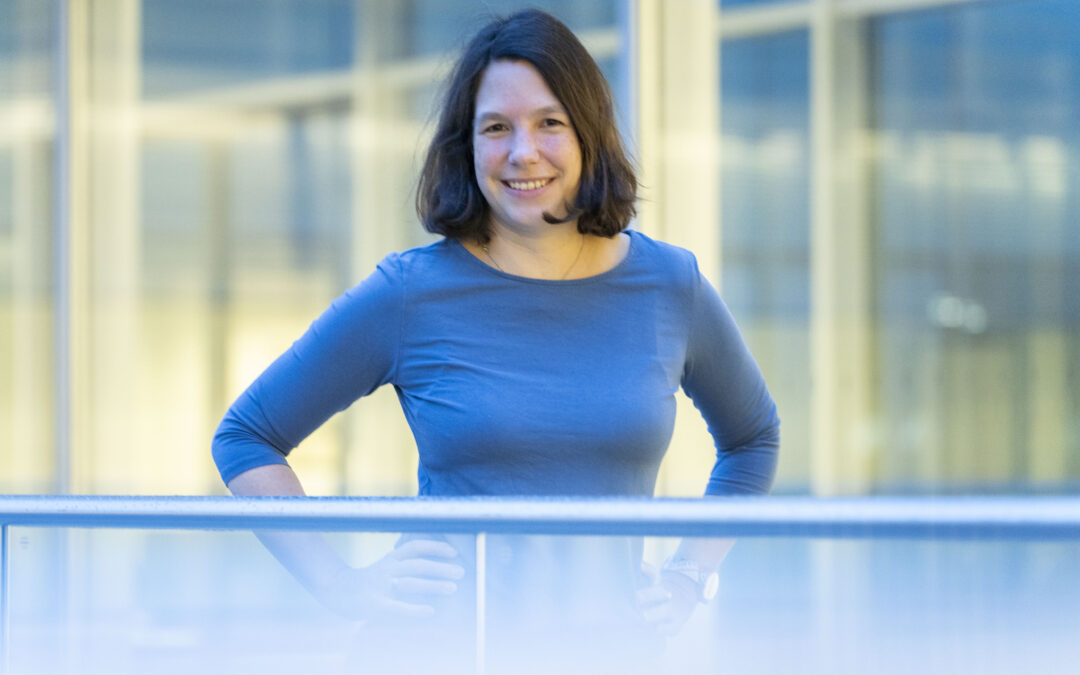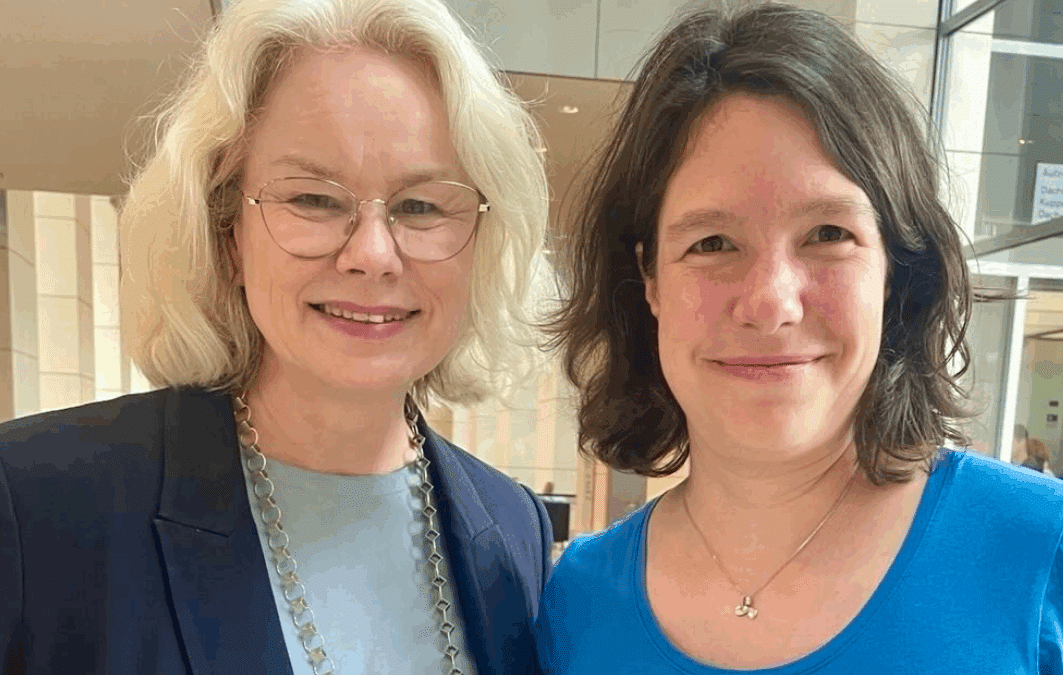
2. Juli 2025
Anlässlich des Kabinettsentwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetzes erklären Linda Heitmann und Kirsten Kappert-Gonther, Mitglieder im Ausschuss für Gesundheit:
Der gezielte Einsatz von K.O.-Tropfen bei Sexualstraftaten ist ein besonders perfides und heimtückisches Verbrechen. Die gesundheitlichen und psychischen Folgen für die Betroffenen sind oft schwerwiegend und begleiten sie häufig ein Leben lang. Es ist deshalb richtig und wichtig, dass GBL nun endlich mit der Aufnahme in das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz stärker reguliert wird, wie es bereits vor knapp einem Jahr von der Ampel-Koalition angestoßen wurde. GBL ist eine bislang recht leicht erhältliche Industrie-Chemikalie, aus der sich K.O.-Tropfen leicht herstellen lassen.
Doch Schwarz-Rot darf nicht vergessen: Allein die Überführung von GBL ins Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz reicht nicht aus. Es braucht umfassende Präventionsarbeit, mehr Aufklärung und Bewusstsein in Bars und Clubs sowie einen wirksamen Opferschutz. Wir setzen uns dafür ein, dass Betroffene von Anfang an ernst genommen und unterstützt werden – sei es im Erstkontakt mit der Polizei, schnelle Testverfahren und medizinische Versorgung oder den Zugang zu rechtlicher Hilfe. Gleichzeitig gilt es zu überwachen, dass die Industrien, die den Stoff dringend benötigen, ihn weiterhin erhalten, ohne dass ein Schwarzmarkt entsteht.
Wir werden den Gesetzentwurf sorgfältig prüfen und uns im weiteren Verfahren dafür einsetzen, dass der Schutz der Opfer und die Prävention Priorität bekommen. Die Regulierung von GBL ist ein wichtiger erster Schritt, aber nur der Anfang.

1. Juli 2025
Die Verabschiedung der Drug-Checking-Verordnung in der heutigen Sitzung des Hamburger Senats kommentiert Linda Heitmann, Berichterstatterin für Drogen- und Suchtpolitik der grünen Bundestagsfraktion, wie folgt:
„Ich begrüße es sehr, dass der Hamburger Senat durch die Verordnung den Weg für Drug-Checking-Projekte frei macht. Damit ergreift Hamburg die Chance, stationäres Drug-Checking umzusetzen. Für dieses Ziel habe ich mich persönlich lange Jahre eingesetzt und konnte in der letzten Legislatur im Bundestag entscheidend daran mitwirken, die bundesweite rechtliche Grundlage dafür zu schaffen.
Leider geht die heute verabschiedete Verordnung des Senates noch nicht ganz so weit, wie sie könnte. Sie ermöglicht erst einmal stationäre Drug-Checking-Projekte sowie Drug-Checking in Konsumräumen. Im nächsten Schritt freue ich mich, wenn der Senat die nächsten Jahre weiter geht und auch mobiles Drug-Checking ermöglicht. Gerade für Festival-Besucher*innen wäre das ein wichtiger Schritt. Für Konsumierende kann Drug-Checking Leben retten und ist ein bedeutendes Standbein einer progressiven Drogenpolitik.“

16. Apr. 2025
Heute habe ich im Tagesspiegel Background Gesundheit und E-Health in der Rubrik „Standpunkt“ einen Namensbeitrag zum Thema Drogen- und Suchtpolitik veröffentlicht:
Die Ergebnisse der Verhandlungsgruppen von Union und SPD sind da und ein Thema muss man dabei mit der Lupe suchen: Drogen- und Suchtpolitik. Gerade mal ein schwammiger Hinweis dazu, dass man Prävention irgendwie stärken und ein bundesweites Nichtraucherschutzgesetz etablieren will. Diese Vernachlässigung ist ein fataler Fehler, denn Drogen- und Suchtpolitik ist ein wichtiger Pfeiler guter Gesundheitspolitik. Was bräuchte es und warum?
Viele denken bei Drogen- und Suchtpolitik an Heroin- oder Crackabhängige. Doch die Volksdrogen Alkohol, Tabak und mittlerweile auch Glücksspiel und Sportwetten sind weit verbreitet und verursachen immense Kosten im Gesundheitssystem. Schätzungen zufolge sterben hierzulande jährlich 40.000 Menschen an den direkten oder indirekten Folgen von Alkohol, die enormen Kosten durch Arbeitsausfälle sind dabei noch nicht eingerechnet. Auch durch Tabak sterben jedes Jahr geschätzte 79.000 Menschen.
Was viel zu oft vergessen wird: Jedes vierte bis fünfte Kind in Deutschland wächst mit mindestens einem suchtkranken Elternteil auf. Diese Kinder tragen eine erdrückende psychische Last, schämen sich oft für die Situation daheim, versuchen sie zu vertuschen und sind viel zu früh auf sich allein gestellt. Sie haben obendrein ein extrem erhöhtes Risiko, selbst suchtkrank zu werden. Die beste Prävention wäre es, hier stärker hinzuschauen und Familien frühzeitig Hilfe und Beratung anzubieten.
Suchtberatung in Deutschland: chronisch unterfinanziert
Doch gerade bei den Beratungsangeboten hakt es: Suchtberatung ist in Deutschland zwar kostenlos und damit erfreulicherweise niedrigschwellig zugänglich, doch ist sie eine Kann-Leistung der Kommunen. Das heißt: Kommunen müssen sie sich leisten können. In Zeiten leerer Kassen trifft es diesen Bereich leider vielerorts oft als Erstes. Wir brauchen verpflichtende Angebote abhängig von der Einwohnerzahl. Denn Suchtberatung ist hoch effektiv: Wenn Betroffene ihre Krankheit anerkennen und zur Therapie bereit sind, können Suchterkrankungen effektiv behandelt werden. Wir haben eines der besten Suchthilfesysteme der Welt, doch viele Betroffene werden nicht erreicht, weil es schon bei der Beratung hakt!
Ebenso wichtig wie Behandlung sollte es uns sein, Suchterkrankungen zu vermeiden. Prävention ist vielschichtig: Studien zeigen, dass die so genannte Verhältnisprävention besonders effektiv ist. Das bedeutet, dass man Lebensumstände so ausgestaltet, dass der Konsum von Suchtmitteln möglichst unattraktiv wird. Konkret heißt das etwa: Werbung und Sponsoring eindämmen oder untersagen, Verkaufsorte und -zeiten für Alkohol und Tabak einschränken, effektive Alterskontrollmaßnahmen beim Verkauf oder auch konsumfreie Zonen im öffentlichen Raum. Einsatzlimits und Abstandsregeln sind insbesondere bei Glücksspiel und Sportwetten effektiv, um Suchtkranke daran zu hindern, unbegrenzt Geld an Automaten oder in Online-Casinos zu verzocken.
Die neue Regierung wäre gut beraten, bei der Verhältnisprävention legaler Suchtmittel voranzugehen. Eine deutliche Mehrheit unterstützt dies: Etwa 80 Prozent befürworten einer Studie von 2023 zufolge starke Einschränkungen von Werbung für Alkohol. Doch mit einer CSU aus Bayern, wo exzessiver Bierkonsum auf dem Oktoberfest mit sieben Millionen Maß Bier zelebriert wird, und Markus Söder meint, auch nach mehreren Bieren noch Auto fahren zu können, darf leider bezweifelt werden, ob Fortschritte möglich werden.
Niedrigschwellige Hilfen statt Kriminalisierung
Abseits von Alkohol und Tabak hat die letzte Regierung mit dem Bundes-Drogenbeauftragten Burkhard Blienert (SPD) eine Kehrtwende in der Drogenpolitik eingeleitet: Weg von Kriminalisierung und Stigmatisierung hin zu mehr Hilfen und akzeptierenden Angeboten. Denn suchtkranke Menschen brauchen Hilfe statt Strafverfolgung.
Bei Cannabis wurde der Paradigmenwechsel besonders kritisch beäugt, aber er ist und bleibt richtig. Umso wichtiger ist, dass wir den eingeschlagenen Weg weitergehen und auch für illegalisierte Substanzen niedrigschwellige Zugänge zu Hilfen und Aufklärung ausbauen. Konkret heißt das: mehr Drogenkonsumräume und Drugchecking-Angebote, Ersatzstofftherapie fördern breiter erforschen.
Die neue Koalition täte gut daran, diese Erkenntnisse anzunehmen und dem Thema in den aktuellen Verhandlungen mehr Raum einzuräumen. Denn eine zeitgemäße Drogen- und Suchtpolitik rettet Leben!
Der Beitrag ist auch auf der Website des Tagesspiegel Background hier zu finden.

30. Mai 2024
Zum Weltnichtrauchertag am 31.05.2024 erklären Linda Heitmann, Mitglied im Gesundheitsausschuss, und Renate Künast, Sprecherin für Ernährung und Landwirtschaft:
Bisher nichtrauchende Jugendliche und zum Teil sogar Kinder steigen immer öfter in den Konsum von E-Zigaretten ein. Der Weltnichtrauchertrag am 31. Mai steht deshalb unter dem Motto „Schutz der Kinder vor dem Einfluss der Tabakindustrie“. Zahlreiche Fach- und Forschungsorganisationen rufen zu Aktionen auf, um öffentlich wirksam über die gesundheitsschädlichen Gefahren von Tabak und Nikotin durch Rauchen und Dampfen aufzuklären. Wir wissen, dass in Deutschland die Zahl der Todesfälle durch klassisches Tabakrauchen weiterhin konstant hoch ist.
Auch wenn Rauchen und Dampfen erst ab 18 Jahren erlaubt ist, beobachten wir insbesondere beim Verkauf von Einweg-e-Zigaretten eine zu lasche Umsetzung des Jugendschutzes. Die Art und Weise der Werbung, auch von Influencerinnen und Influencern bei YouTube und in den Sozialen Medien, trägt dazu bei, einen „Coolness-Faktor“ des Rauchens und Vapens speziell an junge Menschen zu suggerieren. Konsumanreize werden beim Dampfen zudem bewusst durch eine Vielzahl süßer Aromen, Menthol oder Cooling Agents sowie Werbung mit niedrigsten Preisen gesetzt. Dabei fallen chinesische Importe stark auf. Von der Industrie wird außerdem „Harm Reduction“ zu Werbezwecken eingesetzt. Auch das Dampfen schafft massive Gesundheitsgefahren für Lunge, Herz und Kreislauf, besonders bei ganz neuen Konsument*innen.
Im Koalitionsvertrag haben wir uns das Ziel gesetzt, mittels Werberegulierung für Tabak und Nikotin den Jugendschutz zu stärken und Lücken in der Werberegulierung zu schließen. Aromastoffe, die zum Rauchen anreizen oder den Konsum erleichtern, sollten analog zu Tabakerhitzern auch bei E-Zigaretten verboten werden. Wirksamer Nichtraucherschutz braucht Rahmenbedingungen, damit möglichst wenig Menschen nikotinabhängig werden und regelmäßig zu Zigarette, Vape oder Erhitzer greifen. Wir setzen uns daher für einen wirksamen Mix aus Verhaltens- und Verhältnis-Prävention ein, um gerade junge Menschen vor dem Einstieg ins Dampfen oder Rauchen zu schützen. Zigaretten, egal ob klassisch oder E-Zigaretten, dürfen deshalb nicht zu billig verkauft werden. Neben verschärften Einfuhrkontrollen und Aromenverboten ist die geplante Präventionsgesetznovelle zur Förderung der öffentlichen Gesundheit für den Nichtraucherschutz ein dringend notwendiger Baustein.
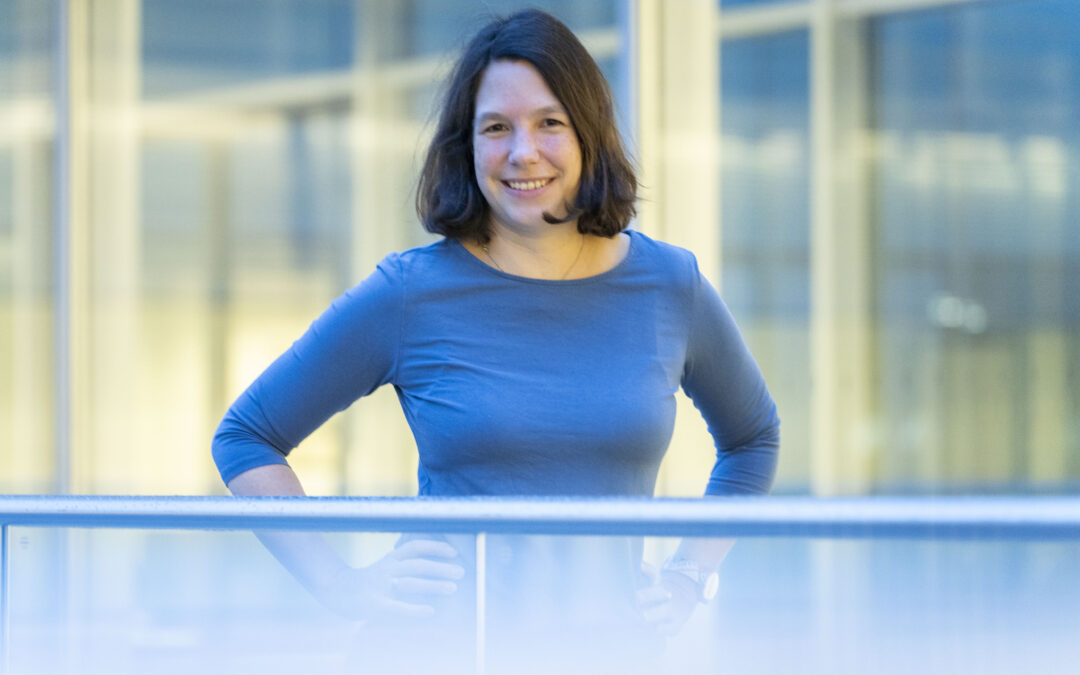
15. Mai 2024
Cannabis: Neue Regeln zu Anbau und Straßenverkehr
Mit der Entkriminalisierung des Cannabis-Anbaus für den Eigenbedarf am 01. April 2024 haben wir in Deutschland einen wichtigen Schritt hin zu einer liberaleren Drogen- und Suchtpolitik getan.
Im Gesetzgebungsverfahren gab es dabei im Bundesrat bei diesem Gesetz keine Mehrheit für eine Überweisung in den Vermittlungsausschuss. Dafür hat die Bundesregierung den Ländern im Rahmen einer Protokollnotiz bestimmte Konkretisierungen des Gesetzes zugesagt. Zudem war das Verkehrsministerium im Gesetz selbst aufgefordert, den THC-Grenzwert im Straßenverkehr gesetzlich neu zu regeln.
Darum bringen wir als Ampel am Donnerstag zwei Gesetzesentwürfe in den Bundestag ein, die zum 01. Juli 2024 in Kraft treten sollen.
Der erste Gesetzesentwurf betrifft den THC-Grenzwert im Straßenverkehr. Mit der Entkriminalisierung des Konsums braucht es auch eine Regel, ab welchem Zeitpunkt man nach dem Konsum wieder als fahrtüchtig gilt und ein Auto fahren darf. Beim Alkohol gilt der 0,5-Promille-Grenzwert. Bei Cannabis ist die Festlegung tatsächlich etwas schwieriger, da die berauschende Wirkung individuell unterschiedlicher ist, als bei Alkohol.
Zur Bestimmung der Fahrtüchtigkeit wird die Konzentration des Cannabis-Wirkstoffs THC im Blutserum gemessen. Der bislang in der Rechtsprechung geltende Grenzwert von einem Nanogramm (ng) pro Milliliter (ml) galt nach Ansicht vieler Expert*innen als deutlich zu niedrig, weil er auch mehrere Tage nach dem Konsum noch nachgewiesen werden kann, wenn die Rauschwirkung lange nicht mehr besteht. Auch bei höheren THC-Werten ist somit nach Einschätzung einer Expertenkommission kein erhöhtes Unfallrisiko mehr vorhanden.
Für uns als Gesetzgeber ist das eine schwierige Situation: Selbstverständlich muss die Sicherheit im Straßenverkehr gewährleistet sein und es muss sichergestellt sein, dass niemand berauscht fährt. Gleichzeitig müssen Regeln auch angemessen sein. Der Gesetzentwurf sieht deshalb nun auf Grundlage der Kommissions-Empfehlung vor, den Grenzwert auf 3,5 ng/ml festzusetzen. Gleichzeitig gilt jedoch: Der Mischkonsum mit Alkohol ist verboten, hier wird die Fahrtüchtigkeit nämlich enorm eingeschränkt. Für Fahranfänger und junge Menschen unter 21 gilt zudem weiterhin ein niedrigerer Grenzwert.
Der zweite Gesetzentwurf betrifft vor allem die Anbauvereinigungen, also die „Cannabis Clubs“. Die Regelung stellt klar, dass sie nicht-kommerzielle Anbauvereinigungen sind, indem in bestimmten Bereichen die Auflagen für die Clubs konkretisiert werden. So dürfen sich Anbauvereinigungen nicht anliegend an angrenzen Anbauflächen ansiedeln. Auch wird die aktive Mitarbeit der Mitglieder in den Anbauvereinigungen betont.