
Rede zum Medizinal-Cannabisgesetz
Am Donnerstag hat der Bundestag in 1. Lesung über die Änderung des Medizinal-Cannabisgesetz debattiert. Ich habe dazu eine Rede gehalten:

Am Donnerstag hat der Bundestag in 1. Lesung über die Änderung des Medizinal-Cannabisgesetz debattiert. Ich habe dazu eine Rede gehalten:

Gestern hat der Bundestag zur Beschlussempfehlung des Wahlprüfungsausschuss zu Einsprüchen zur Bundestagswahl 2025 beraten. Ich habe dabei auch eine Rede gehalten. Zur Entscheidung habe ich auch bereits vor einigen Wochen ein Statement veröffentlicht, dieses findet ihr hier.

Zur absehbaren Einigung zum GKV-Sparpaket im Vermittlungsausschuss habe ich heute ein Statement veröffentlicht:
„Der Vermittlungsausschuss zum GKV-Finanzstabilisierungspaket birgt keine Lösung für die Unterfinanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung, sondern verschiebt nur die Probleme auf die kommenden Jahre. Die Bundesregierung legt einen so genannten „Kompromiss“ vor, der weder Zusatzbeiträge verhindert noch echte Strukturreformen bringt. Die vorgeschlagenen Einsparungen werden als Belastungen in die Zukunft geschoben und belasten die Krankenkassen und damit alle Versicherten, während Kassenärzte und Pharmaindustrie auch diesmal wieder verschont bleiben – das ist ein Nullsummenspiel und Verschiebebahnhof, weder fair noch ausgegoren. Diese Maßnahmen werden die finanzielle Stabilität nicht sichern, sondern erzeugen nur kurzfristige Illusionen, die schnell platzen werden und die Versorgung gefährden.
Wir Grüne fordern schon lange: Wesentliche versicherungsfremde Leistungen wie Gesundheitskosten für Bürgergeldempfänger müssen aus Steuermitteln finanziert werden, statt die Belastungen auf Beiträge abzuwälzen. Daher unterstützen wir ausdrücklich die Initiative aus Baden-Württemberg hierzu im Bundesrat. Auch die Pharmaindustrie muss in ihrer Preisbildung bei Medikamenten endlich klare Vorgaben bekommen – dazu machen wir Grüne mit einem Antrag im Bundestag diese Woche konkrete Vorschläge. Die Regierung muss gegensteuern und einseitige Kürzungen stoppen, die die Schwächsten treffen und die Qualität der Versorgung aushöhlen. Strukturelle Reformen in Krankenhausfinanzierung, Arzneimittelvergütung und Notfallversorgung sind dringend geboten.“
Zu diesem Thema hat auch das Deutsche Ärzteblatt hier berichtet.

Der Tagesspiegel-Background berichtet heute exklusiv zu den Ergebnissen meiner Anfrage zum Thema Cannabis-Modellprojekte. Die Kleine Anfrage thematisiert die schleppende Umsetzung und bisher zu beobachtende Ablehnung beantragter wissenschaftlicher Modellprojekte zur kontrollierten Abgabe von Cannabis nach der Entkriminalisierung 2024. Ich habe dazu gefragt, warum die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) bislang keine entsprechenden Forschungsprojekte genehmigt hat, obwohl dies unter der sogenannten Forschungsklausel im Cannabisgesetz möglich wäre.
Mein Statement dazu:
„Die Antwort der Bundesregierung offenbart deren fatale Blockadehaltung in der weiteren Entwicklung der Drogen- und Suchtpolitik im Bereich Cannabis. Obwohl das Cannabisgesetz ausdrücklich Forschung ermöglicht, wurde bisher kein einziges wissenschaftliches Modellprojekt genehmigt: 65 Anträge liegen vor, mehrere wurden bisher abgelehnt. Damit verhindert die Regierung genau die Studien, die zeigen könnten, wie regulierte Abgabe Jugendschutz stärken kann, Gesundheit besser schützt und den Schwarzmarkt zurückdrängt.
Die Teil-Legalisierung von Cannabis ist eine drogenpolitische Erfolgsgeschichte. Die Entkriminalisierung entlastet Polizei und Justiz deutlich, die Verfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sind spürbar zurückgegangen. Anstatt diesen Erfolg weiterzuentwickeln, verweigert die Bundesregierung Transparenz und schiebt die Verantwortung für die Umsetzung des Gesetzes vollständig auf die Länder ab.
Wir als Grüne stehen für eine Drogen- und Suchtpolitik, die auf Wissenschaft statt Ideologie setzt. Dazu gehören wissenschaftlich begleitete Modellprojekte, klare Regeln für Abgabe an Erwachsene in Fachgeschäften, starke Prävention, verlässlicher Kinder- und Jugendschutz und eine konsequente Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Die heutige Antwort der Bundesregierung zeigt: Diese Modernisierung wird es mit CDU/CSU und SPD nicht geben, sie bleibt Aufgabe einer progressiven Mehrheit im Bundestag, die sich hoffentlich in Zukunft wieder ergeben wird.“
Misbah Khan, stellvertretende Vorsitzende der Grünen Bundestagfraktion:
„Die Antwort auf unsere Kleine Anfrage legt offen, dass die Bundesregierung über keinerlei belastbare Daten verfügt, um eine realistische Einschätzung der Lage vorzunehmen. Gleichzeitig wird die Teil-Legalisierung von zahlreichen Stimmen innerhalb der Regierung immer wieder als großes „Unheil“ stilisiert. Statt auf Fakten zu setzen, wird das Thema Cannabis offenbar aus einer rein ideologischen Perspektive angegangen, die sich gegen die rund 4,5 Millionen Konsumenten richtet. Eine evidenzbasierte Sucht- und Drogenpolitik wäre gesamtgesellschaftlich von großer Bedeutung. Dass sich die Bundesregierung jedoch dieser Verantwortung entzieht und politisch motiviert vorgeht, ist ein großes Versäumnis.“
Den ganzen Artikel im Tagesspiegel Background findet ihr hier.

Die aktuellen Zahlen des Public Health Index sind veröffentlicht und lassen Deutschland nicht gut aussehen: wir belegen lediglich den 17. von 18 Plätzen der Staaten in Nord- und Zentraleuropa.
Konkret untersucht wurde, wie gut die Staaten die WHO-Empfehlungen zur Gesundheitsvorsorge umsetzen. Die AOK und das Deutsche Krebsforschungszentrum haben darin gemeinsam die Handlungsfelder Tabak, Alkohol, Ernährung und Bewegung untersucht. Insbesondere bei den Kategorien zur Eindämmung des Tabak- und Alkoholkonsums sowie der gesunden Ernährung schneidet Deutschland schlecht ab. Besonderer Nachholbedarf wird Deutschland bescheinigt bei strukturellen Präventions-Maßnahmen wie gesundheitsorientierter Besteuerung, Regelungen zur Werbung und Marketing sowie der Gestaltung des Angebots und der Verfügbarkeit gesundheitsschädlicher Konsumgüter.
Dass Deutschland in den genannten Handlungsfeldern so schlecht abschneidet, ist wenig überraschend und trotzdem erschreckend. Trotz der jahrzehntelang bekannten Gefahren durch das Tabakrauchen, raucht in Deutschland immer noch knapp vierte erwachsene Person. Allein der volkswirtschaftliche Schaden durch den Tabakkonsum ist mit 97 Milliarden Euro jährlich daher enorm. Prävention wird politischweiter hintenangestellt. Und das, obwohl es viele wirksame Maßnahmen gibt. Wir als BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen uns seit vielen Jahren für eine Erhöhung der Tabaksteuer, ein umfassendes Werbe- und Sponsoringverbot sowie besseren Nichtraucherschutz ein.
Darüber machen wir uns dafür stark, auch beim Alkoholkonsum den Jugendschutz und die Prävention wirksam zu stärken, indem ähnliche Maßnahmen wie bei Tabak endlich angegangen werden. Das heißt konkret z.B. höhere Steuern, eine Begrenzung der Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit und umfassende Werbeeinschränkungen.
Insbesondere beim Kinder- und Jugendschutz ist in Deutschland noch viel zu tun. An oberster Stelle sollte der Schutz von Kindern- und Jugendlichen, aber auch in Bezug auf das Rauchen, der Nichtraucher*innenschutz stehen. So schnell wie nur möglich bedarf es hier wirksamer Maßnahmen.
Prävention muss nicht nur teuer sein, mit Prävention lässt sich sowohl direkt, über Steuern, als auch indirekt, über eine Senkung der Krankheitslast, Geld verdienen. Denn mittlerweile sollte klar sein, dass nur eines teurer ist als Prävention – nämlich keine Prävention.
Zu den Themen Verhältnisprävention bei Suchtmitteln sowie Nichtraucherschutz habe ich mich in der Vergangenheit bereits mehrfach klar geäußert und unsere politische Linie verdeutlicht.
So zum Beispiel in dieser Rede im Bundestag zum Thema Verhältnisprävention, diese findet ihr hier.
Oder auch im Morgenmagazin von ARD und ZDF zum Thema Nichtraucherschutz, den Beitrag findet ihr hier.

Heute hat der Bundestag über das Wehrdienst-Modernisierungsdienst abgestimmt. Mit der Grünen-Fraktion habe ich das Gesetz abgelehnt. Meine Gründe dazu habe ich mit mehreren anderen Abgeordneten in einer Erklärung zur Abstimmung nach §31 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags zu Protokoll gegeben. Die ganze Erklärung hier:
Die heutige Abstimmung über das Wehrdienstmodernisierungsgesetz fällt uns nicht leicht. Deutschlands und Europas Sicherheit sind bedroht. Es ist deshalb nötig, dass die Bundeswehr wieder in eine Lage versetzt wird, in der sie ohne Zweifel jeden bewaffneten Angriff auf Landes- oder Bündnisgebiet stoppen könnte, immer mit dem Ziel, dass es diesen Angriff nie geben wird. Dazu braucht es auch mehr Soldatinnen und Soldaten. Es ist deshalb richtig, die Bundeswehr attraktiver zu machen, um mehr Freiwillige zu finden. Es ist angesichts der Bedrohungslage auch richtig, die Musterung wieder verpflichtend zu machen und auch dabei jungen Leuten die Bundeswehr und die Möglichkeit einer freiwilligen Verpflichtung näher zu bringen.
Wir haben trotzdem das Wehrdienstmodernisierungsgesetz heute abgelehnt. Weil in diesem Gesetz schon skizziert wird, dass der nächste Schritt, falls sich nicht genügend Freiwillige melden, die Wiedereinsetzung der 2011 ausgesetzten Wehrpflicht alten Typs wäre. Das Gesetz verpflichtet nur Männer zur Musterung und blickt allein auf den Wehrdienst, nicht auf die vielen anderen, für unsere gesamtgesellschaftliche Resilienz ebenfalls bedeutsamen gesellschaftlichen Dienste. Falls sich nicht ausreichend Freiwillige melden, will man eine Bedarfswehrpflicht, die dann im Losverfahren eine Zufallspflicht nur für junge Männer wäre.
Die Wehrpflicht alten Typs sieht auch ausdrücklich den Dienst an der Waffe als Regelfall und die richtigerweise grundgesetzlich als Grundrecht garantierte Kriegsdienstverweigerung als nur aus Gewissensgründen eigens zu begründende Ausnahme vor. Wir sind uns bewusst, dass in der gegenwärtigen Bedrohungslage eine Pflicht zum Wehrdienst nicht ausgeschlossen werden kann, aber wenn eine Dienstpflicht nötig wäre, dann müsste sie nicht nur für Männer gelten und nicht wieder ein gesondertes Verfahren für die Verweigerung beinhalten. Stattdessen sollte es die freie Wahl geben, ob dieser Dienst bei der Bundeswehr, im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz oder im sozialen oder ökologischen Bereich geleistet wird: Ein Gesellschaftsjahr für alle.
Wir sind uns bewusst, dass eine solche Debatte über gesellschaftliche
Verantwortung kontrovers ist. Sie berührt individuelle Freiheit und verlangt nach sorgfältiger politischer Abwägung und breitem gesellschaftlichem Konsens, weil auch eine Änderung des Grundgesetzes nötig wäre. Doch gerade in Zeiten, in denen unsere Demokratie von innen wie außen bedroht ist, brauchen wir eine gemeinsame Antwort. Ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr könnte ein Gemeinschaftsprojekt für die Freiheit, die Demokratie und die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft werden. Wir sind überzeugt: Die Investition in Zusammenhalt, Resilienz und Demokratie würde sich lohnen.
Das heute zur Abstimmung vorgelegte Wehrdienstmodernisierungsgesetz greift hier viel zu kurz.
Deshalb haben wir das Wehrdienstmodernisierungsgesetz der Bundesregierung abgelehnt und dem Entschließungsantrag der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen zugestimmt, in dem die Einsetzung einer Enquete-Kommission für gesamtgesellschaftliche Resilienz gefordert wird. Ziel ist ein ergebnisoffener Diskussionsprozess darüber, wie militärische und zivile Dienstformen – freiwillige, hybride und verpflichtende – sowie weitere Formen gesellschaftlicher Mitwirkung zur Gesamtverteidigung und Resilienz beitragen können. Wichtig ist uns, dass die Erlangung gesellschaftlicher Resilienz nicht nur eine Aufgabe der jungen Generation, sondern aller Generationen ist. In die Arbeit einer solchen Enquete- Kommission sollen alle Beteiligten und Betroffenen, insbesondere und maßgeblich junge Menschen, einbezogen werden.
Berlin, 05.12.2025
Persönliche Erklärung nach §31 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages zum Abstimmungsverhalten am 05. Dezember 2025 zum Tagesordnungspunkt 27 der Plenardebatte zur zweiten und dritten Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Modernisierung des Wehrdienstes (Wehrdienst-Modernisierungsgesetz – WDModG)

Anlässlich des heutigen Beschlusses gegen eine Neuauszählung der Bundestagswahl 2025 erklärt Linda Heitmann, Mitglied im Wahlprüfungsausschuss:
„Die sorgfältige und transparente Prüfung der Ordnungsgemäßheit einer Wahl ist unabdingbar, damit das Vertrauen in die Ergebnisse von Wahlen gestärkt wird. Entsprechend hat der Wahlprüfungsausschuss den vorgetragenen Sachverhalt unter Berücksichtigung der Stellungnahmen der Bundes- und Landeswahlleiter*innen sorgfältig geprüft und festgestellt, dass nach dem Vortrag der Einspruchsführer keine mandatsrelevanten Wahlfehler erkennbar sind. Eine Entscheidung des Bundestages über die Einsprüche des BSW gerichtet auf Neuauszählung soll noch in diesem Jahr erfolgen, damit die Einspruchsführer endlich Klarheit haben – auch mit Blick auf die Möglichkeit der nachgelagerten Kontrolle durch das Bundesverfassungsgericht.
In der letzten Legislatur hat in Folge der Prüfungen des Ausschusses tatsächlich auch eine Neuwahl in einigen Teilen Berlins stattgefunden, in denen Wahlfehler in mandatsrelevanter Größenordnung festgestellt wurden. Im Falle der Vorwürfe des BSW hat sich der Sachverhalt nun deutlich anders dargestellt. Wir begrüßen diese sachliche Klärung und danke allen Beteiligten für ihre engagierte Arbeit im Ausschuss.“
Zu diesem Thema hat u.a. die Deutsche Welle hier berichtet.
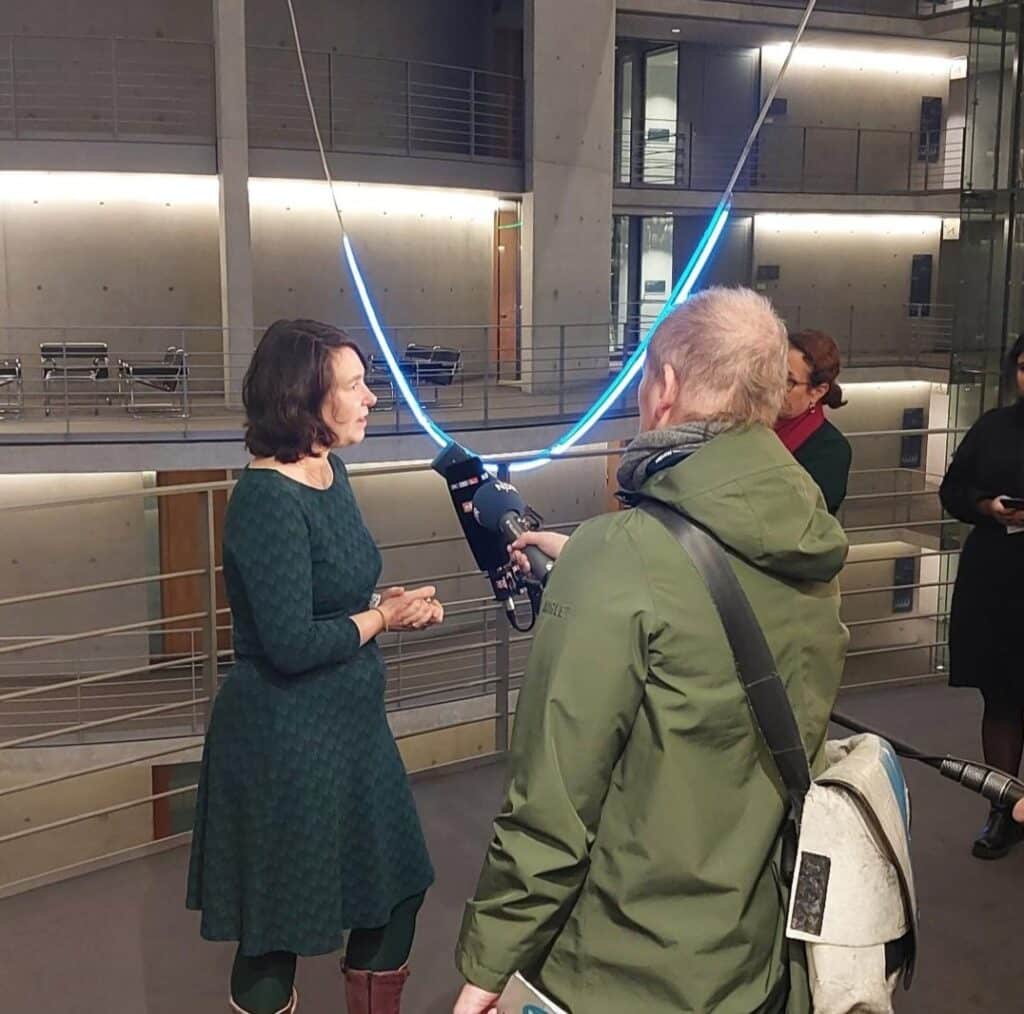

Neues aus der Corona-Enquete-Kommission!
Vorgestern haben sich die fünf Arbeitsgruppen der Enquete-Kommission offiziell konstituiert. Damit ist der Startschuss gefallen, um die zentralen Themen der Pandemie noch einmal intensiv und aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten.
Ich arbeite in der Arbeitsgruppe „Wirtschaft, Arbeit, Wirtschaftshilfen, Versorgung und Verfügbarkeiten“. Ein wichtiges Feld, in dem wir die Auswirkungen und Entscheidungen der Pandemie reflektieren und gemeinsam Handlungsempfehlungen entwickeln.
Heute stand die Besetzung der Gruppen und die Wahl der Koordination im Mittelpunkt, unsere Arbeitsgruppe hat Jens Peick (SPD) zum Koordinator gewählt. Für die stellvertretende Koordination hatte die AfD das Vorschlagsrecht, ihre Kandidaten haben dort aber keine Mehrheit erhalten.
Ab jetzt geht es richtig los – und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und die kommenden Diskussionen!

Diese Woche diskutieren wir im Bundestag den Bundeshaushaltsentwurf für 2026. Ich habe dabei in der Debatte zum Gesundheitsministerium eine Rede gehalten. Ich habe dabei besonders die Finanzierungssituation der Gesetzlichen Krankenkassen in den Blick genommen. Die ganze Rede findet ihr hier:
Über meine Rede und die Haushaltsdebatte hat u.a. das Ärzteblatt berichtet.

Als Berichterstatterin der Grünen Fraktion für Wahlrecht und Bürgerbeteiligung habe ich heute den Haushaltsentwurf 2026 für diese Bereiche kommentiert:
„Die Bundesregierung verabschiedet sich von der Bürgerbeteiligung – und das im Widerspruch zu ihrem eigenen Koalitionsvertrag. Wer Bürgerräte verspricht und dann die Mittel streicht, verspielt Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Die Regierung tritt die Idee der Mitbestimmung mit Füßen und zeigt: Wenn es ernst wird, hat echte Beteiligung keinen Platz.
SPD und Union haben im Koalitionsvertrag vereinbart: „Ergänzend zur repräsentativen Demokratie setzen wir dialogische Beteiligungsformate wie zivilgesellschaftliche Bürgerräte des Deutschen Bundestages fort.“ Doch zum zweiten Mal werden im Haushalt keine Mittel dafür eingestellt – der Todesstoß für die engagierte Stabsstelle bei der Bundestagsverwaltung. Union und SPD müssen ihre Ankündigungen endlich ernst nehmen, denn politische Teilhabe lebt vom sichtbaren Handeln und den echten Möglichkeiten zur Mitgestaltung. Nur so wird Demokratie für die Menschen erlebbar und das Vertrauen in unsere Parlamente und den gesellschaftlichen Zusammenhalt gestärkt.“
Auch der BR hat diesem Thema einen Beitrag gewidmet, diesen findet ihr hier.